Eigentlich wollte er nur den Grünbereich hinter seinem Haus einebnen. Dabei ergab es sich günstig, dass sein Nachbar gerade dabei war, einen kleinen Hang vor seinem Haus abzutragen, um einen Stellplatz für sein Auto herzurichten.
Der Abraum wurde also umgesetzt von einer Straßenseite zur andern und von oben nach unten. Die Erdschicht, die zuvor tiefer gelegen hatte, gelangte so an die Oberfläche.
Noch bevor die neu geschaffene Fläche mit Rasen eingesäät wurde, verwandelte sie sich, begünstigt durch Regen, Sonne und die richtige Mondphase, plötzlich in ein Feld mit Schlafmohn.
Wie war das möglich?

Gab es vielleicht in früheren Zeiten am Seeende einmal Schlafmohnkulturen, so wie sie heute viele von uns nur von Bildern aus dem fernen Osten kennen? Kann es sein, dass die Samen dieser opiumhaltigen Pflanze in einer unteren Erdschicht über Generationen hinweg keimfähig geblieben sind und nun diese erste und einzige Gelegenheit ergriffen, wieder auszutreiben? Gab es in früheren Zeiten Schlafmohnanbau in Ludwigshafen und Umgebung?
Zweifelsohne, meint Wolf-Dietrich Specht ein Mitbürger der älteren Generation, der sich noch an blau-violett blühende Mohnlandschaften zwischen Ludwigshafen und Stockach erinnert.

Von Edgar Sinner wissen wir, dass in seinem Elternhaus am Ende der Haldenhofstraße gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine mit dem Wasser des Gießbaches gespeiste Ölmühle für Mohn betrieben wurde.
Von Menschen, die in den 1930er Jahren das Licht der Welt erblickten, ist noch zu erfahren , dass manche Eltern ihre Kleinkinder mit einem sogenannten Mohnkissen oder Mohnsäckchen ins Land der Träume schickten, das sie ihnen zum Lutschen in den Mund schoben, wenn sie sich z.B. bei der Feldarbeit nicht um sie kümmern konnten. Die Wirkstoffe des Schlafmohnsamens, ob frisch oder getrocknet wissen wir nicht, wurden dazu mit Milch ausgezogen.

Dank dieses „morphiumgetränkten“ textilen Schnullers schliefen die Kleinen gut und lange. Ob es auch ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung zuträglich war, darf bezweifelt werden. Aus diesem Grund griffen nicht alle Eltern damals zu diesem rauschgifthaltigen Beruhigungsmittel.
Es soll auch heute noch Fälle geben, wo Eltern -angeleitet durch Koch- oder Heilkräuterbücher- mit diesem Verfahren experimentieren, wenn sie dem Geschrei ihrer Kinder nachts nicht mehr Herr werden. Das scheint mit dem in Lebensmittelgeschäften erhältlichen Back- oder Blaumohn möglich zu sein, wenn man eine entsprechend große Mengen davon verwendet. Denn Back- oder Blaumohn ist nichts anderes als eine Variante des Schlafmohns. Daher endet das Experiment für manche Kinder in der Notaufnahme eines Krankenhauses.
Obwohl die ölreichen Samen des Backmohns nahezu frei von Opium-Alkaloiden sind, haben Untersuchungen gezeigt, dass Mohnsamen je nach Herkunft sehr unterschiedliche Mengen dieser natürlichen Inhaltsstoffe enthält. Der Morphingehalt kann um den Faktor 100 variieren.
Durch Recherchen in historischen Dokumenten und alten Lokalzeitungen stießen wir auf weitere interessante Informationen zum Mohnanbau in unserer Region.
Im Stockacher Tagblatt von 1917 wird zum Mohnanbau aufgerufen sowohl wegen der guten Ölausbeute, als auch wegen seiner geringen Ansprüche an Boden und Witterung. In Süddeutschland sei sein Anbau für die Ölgewinnung für den Hausgebrauch schon immer heimisch gewesen, auch im Hausgarten. Fast jeder Bauer hätte ein Feldstück mit Mohn besät.
Aus einer alten Abgabenliste der Gemeinde Ludwigshafen geht hervor, dass neben Brotgetreide und Milch, Heu und Stroh auch die Ölfrucht Mohn abzuliefern war. Zu den größten Mohnproduzenten gehörten demnach Leopold Ill, Ulrich Martin, Ignaz Specht und die Höfe von Oskar Keller und Rudolf Hauser.

Der Mohnanbau wurde von den Nationalsozialisten während des 2. Weltkrieges gefördert. In der Bodensee-Rundschau, dem nationalsozialistisches Kampfblatt für das deutsche Bodenseegebiet Jg. 1942 (11), ist zu lesen: „Seit Beginn der Erzeugungsschlachten wurde eine Verstärkung des Ölfrüchteanbaus angestrebt, um auch die Fettquelle des Bodens ganz zu erschließen. Für unsere Kriegsernährungswirtschaft ist eine erneute Ausweitung des Anbaus zu einer vordringlichen Aufgabe geworden.“ Bereits in der Ausgabe von 1940 (9) ist von einer Verteilung von zusätzlichen 1.700 Kilogramm Mohnsaat an die Badischen Bauern und einer dadurch erzielten Erweiterung der Anbaufläche um 400 Hektar die Rede.
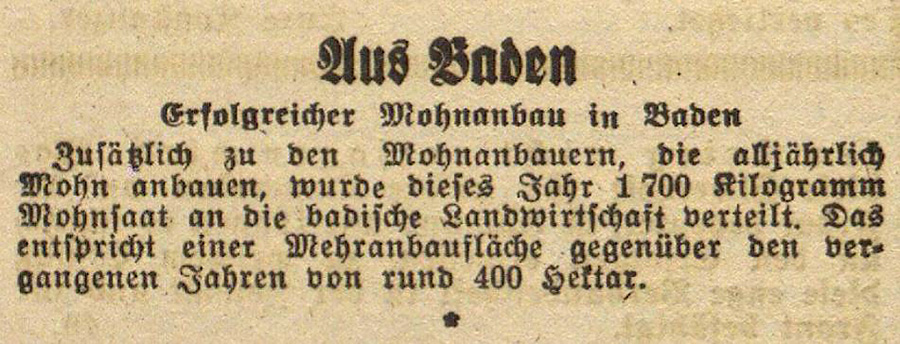

Wolf-Dietrich Specht ist sich sicher, dass die wieder zum Leben erwachten Mohnsamen im Garten von einem der beiden Nachbarn nicht von einem früheren landwirtschaftlichen Mohnfeld stammen, sondern von dem ehemaligen Blumenbeet, das der frühere Hausbesitzer des anderen Nachbarn angelegt hatte. Aber nichts desto trotz, Schlafmohn ist und bleibt auch als Zierpflanze Papaver somniferum, also ein opiumhaltiger Schlafmohn und ist als solcher erlaubnispflichtig, unabhängig von der Zahl der Pflanzen, und zwar sowohl bei gewerblicher als auch bei privater Nutzung. Er fällt in Deutschland seit 1930 unter das Betäubungsmittelgesetz und darf nur mit Sondergenehmigung der Bundesopiumstelle angebaut werden. Selbst die morphinarmen Küchenmohn-Sorten unterliegen seit dem Jahr 1978 dem Betäubungsmittelgesetz. Man darf Mohnsamen kaufen, besitzen und mit ihnen handeln. Wer Schlafmohn aber ohne Genehmigung in seinem Garten aussät, macht sich strafbar und kann mit bis zu fünf, in schweren Fällen sogar fünfzehn Jahren Gefängnis bestraft werden.

Da der von der Schlafmohnpracht in seinem Garten überraschte Mitbürger von keinen bösenwilligen Nachbarn umgeben ist, denen es Spaß gemacht hätte, ihn anzuzeigen, hatte er keine Konsequenzen zu fürchten. Und da er die einjährigen Pflanzen noch vor der Samenreife abmähte, ist davon auszugehen, dass diesem Spuk ein für allemal der Garaus gemacht wurde. Und so war es auch.
Im Folgejahr reckte kein einziges Schlafmohnblümchen mehr sein Köpfchen der Sonne entgegen.




