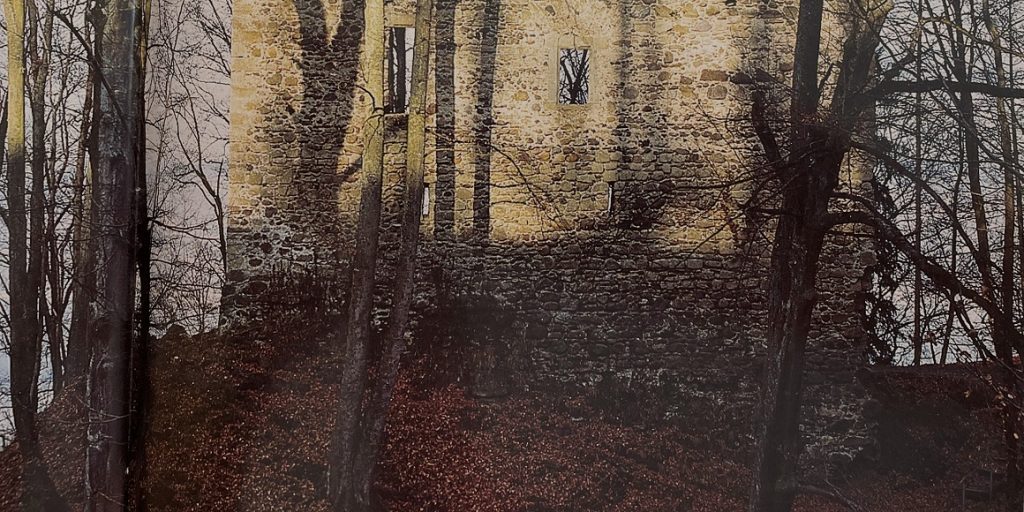Mit freundlicher Unterstützung von Ronald und Jürgen Winterhalter
Für alle Kinder im „Oberdorf“ von Ludwigshafen war sie die Tante Luis, obwohl sie im Ort weder Neffen noch Nichten hatte. Die Erwachsenen nannten sie d’Sulgerluis. Sie führte den kleinen Krämerladen von Adolf Sulger gegenüber der katholischen Kirche weiter. Wer sie als Kind in ihrem Lädele erlebte, hat sie als kleine, zierliche Person in Erinnerung, freundlich, bescheiden und zurückhaltend.
Kein Kind verließ jemals den Laden der Tante Luis ohne aus einem der Süßigkeitengläser einen Keks oder ein Guëtzele erhalten zu haben. Viele würden sogar behaupten, dass ein Besuch manchmal auch ohne etwas einzukaufen mit einem „Leckerli“ belohnt wurde. Natürlich nur aus den Händen von Tante Luis. Von Mimi, ihrer treuen Gehilfin, waren keine milden Gaben zu erwarten. Mimi war streng, verantwortungsbewusst und unnachgiebig. Es war ihr klar, dass man über fremdes Eigentum nicht eigenmächtig verfügen darf. Bettelnde Kinderaugen konnten ihr daher nichts anhaben.
Wir Kleinen, die wir -wie alle Kinder- unsere Zeit nicht damit verloren, uns Gedanken darüber zu machen, wie Erwachsene und alte Menschen in jungen Jahren waren, ahnten nicht, welch fester Wille, welch starker Charakter und welch fleißige Natur hinter dem sanften Gemüt „unserer“ Tante Luis steckten. Worüber wir rätselten, was wir uns aber nicht zu fragen getrauten, war, weshalb ihr einige Fingerglieder der linken Hand fehlten. Das kannten wir nur von Zimmerleuten, Tischlern oder Schreinern. Wie konnte so etwas der Tante Luis passiert sein? Beim Mosten hatte sie mit der Hand in die Obstmühle gegriffen, so war’s.


Luise Sulger war unverheiratet und kinderlos. Es heißt, sie hätte kurz vor der Trauung die Hochzeit abgesagt, weil sie festgestellt hatte oder ihr zugetragen worden war, dass ihr Bräutigam ein größeres Interesse an ihrem Hab und Gut hatte, als an ihr selbst. Ohne Lebensgefährten war es ihr Schicksal, zeitlebens für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Doch das wusste sie zu meistern. Sie war eine vielseitig erfahrene und geschickte Selbstversorgerin, hielt ein paar Ziegen, züchtete Kaninchen, pflegte die Imkerei und erntete Obst und Gemüse aus Feld und Garten. Und da war ja auch noch ihr Laden, der jeden Tag außer mittwochnachmittags und an Sonn- und Feiertagen geöffnet hatte. Dort fand sich von allem etwas. Lebensmittel und andere Dinge für den Haushalt, auch Spielsachen und Geschenkartikel etc. Gab es etwas nicht, soll sie gesagt haben: „De Waggë war noit do.“
Als alleinstehende, zierliche Frau fühlte sie sich verständlicherweise verletzlich. Daher hing neben ihrer Haustüre oft ein Herrenhut, um die Hausierer, Handwerksburschen und Bettler, die in früherer Zeit noch zahlreich unterwegs waren, glauben zu lassen, dass es einen Mann im Haus gibt.
Ihre getreue Gehilfin Mimi, eine Tochter der Familie Hockenjos, die im Haus über dem Laden wohnte, hat ihr viel zu verdanken. Luise Sulger hielt die geistig beeinträchtigte Mimi beherzt und unerschrocken bei sich versteckt, als die Nazis in den Jahren 1939-1941 im Rahmen ihres Euthanasieprogramms, der „Aktion T4“, unverhohlen die Ermordung von Menschen betrieben, die sie für „lebensunwert“ hielten und als eine genetische und finanzielle Belastung für die deutsche Gesellschaft und den Staat erachteten. Dadurch blieb Mimi ein grausames Los erspart.
Mehr noch! Tante Luis beschäftigte Mimi später in ihrem Krämerladen, solange sie ihn führte, und praktizierte damit das Prinzip der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen, lange bevor dieser Begriff geprägt wurde.
Menschen, wie Tante Luis, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, die aus wenig viel machen und im Kleinen Großes bewirken, findet man nicht überall. Aber es gibt sie auch heute noch. Wer einen Blick für sie hat, findet sie.