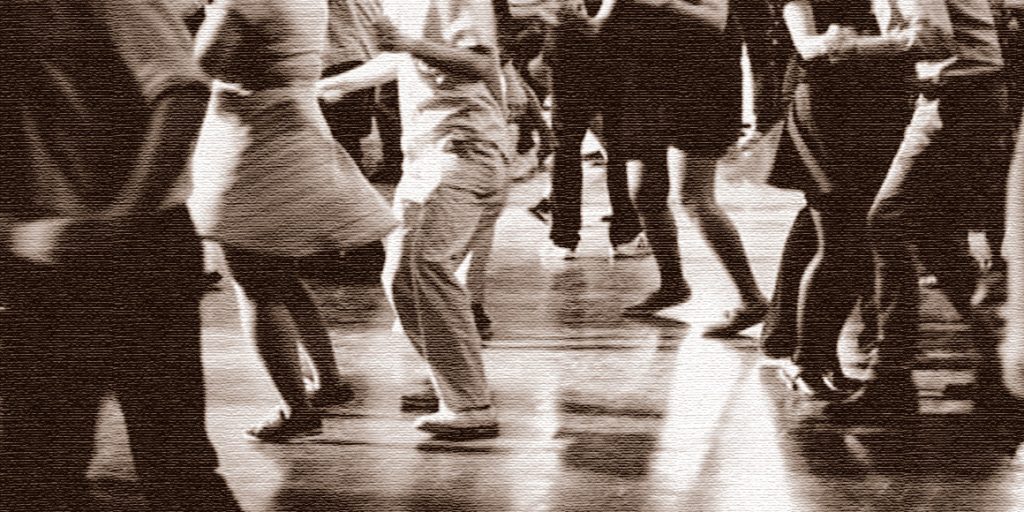Das im Oktober 1524 vereinbarte Stillhalteabkommen zwischen Adel und Aufständischen sollte im Januar 1525 zu Waffenstillstandsverhandlungen führen. Die Städte Radolfzell, Überlingen, Schaffhausen und Stein am Rhein versuchten zu vermitteln, die vorderösterreichische Regierung und der Nellenburger Landvogt hingegen plädierten für ein hartes Durchgreifen.
Zwei Verhandlungstage in Radolfzell und Stockach, die vor allem den Stühlinger Aufruhr befrieden sollten, blieben ohne Ergebnis, da die Bauern das nur mit dem Adel besetzte Gericht nicht anerkannten.
Eine dramatische Wendung erfolgte, als Ulrich von Württemberg, der 1519 durch den „Schwäbischen Bund“ aus Württemberg vertrieben worden war und 1521 den Hohentwiel erworben hatte, sich mit den aufständischen Bauern verbündete, in der Hoffnung, mit diesem „Haufen“ sein Herzogtum zurückzuerobern. Am 24. Februar 1525 startete er seinen Eroberungsfeldzug in Richtung Stuttgart, gefolgt von einigen hundert Bauern aus dem Schwarzwald und Hegau.

Am 1. März wurde diese Bauernnachhut am Lochen-Pass bei Balingen durch Bundestruppen angegriffen und aufgerieben, bei dem 200 Bauern ihr Leben verloren. In diesem Monat wurde der Aufstand der Bauern im Hegau und anderen Gebieten von Süddeutschland zum Flächenbrand, zum Bauernkrieg. Nahezu alle Dörfer im Hegau und auf dem Bodanrück hatten sich mit den Bauern solidarisiert. Die Gemeinden wurden von den Aufständischen aufgefordert, sich der „Christlichen Bruderschaft“ anzuschließen, andernfalls würden sie geplündert, gebrandschatzt und zerstört. Bodman und Espasingen hielten zu ihrem Grundherrn Hans Jörg von Bodman und waren bereit, ihre Dörfer und Burgen gegen den Bauernhaufen zu verteidigen. Drei Tage lang wurde die Burg des herrschaftstreu gebliebenen Dorfes Bodman belagert. Es gelang den Bauern aber nicht die Burg zu erobern, aber das Dorf wurde geplündert und gebrandschatzt. Die unbewohnte Burg Kargegg, oberhalb der Marienschlucht gelegen, wurde niedergebrannt und nie wieder aufgebaut.
Da die Aufständischen gedroht hatten, auch Sernatingen anzugreifen, entsandte die Reichsstadt Überlingen am 24. Mai rund 3.000 Mann nach Sernatingen, was in einem Waffenstillstand endete. Dieser Aufmarsch der Überlinger ist als „Sernatingische Handlung“ in die Regionalgeschichte eingegangen, da am 27. Mai 300 rekrutierte reichstädtische Bauern meuterten und sich weigerten, gegen die Aufständischen zu kämpfen. Die 300 Meuterer wurden eingekesselt und grausam bestraft.


Sieben Kriegsdienstverweigerer wurden am 28. Mai auf dem Brühl (Im Briel) zu Sernatingen mit dem Schwert hingerichtet, 15 weitere am 30. Mai auf der Hofstatt in Überlingen enthauptet.
In den darauffolgenden Monaten Juni und Juli gab es immer wieder Kämpfe und Auseinandersetzungen zwischen den Aufständischen und den Bundestruppen. Trotz der anfänglichen Entschlossenheit der Bauern waren diese schlecht ausgerüstet und militärisch unerfahren. Die lokalen Adligen und Fürsten organisierten, unterstützt durch Söldner und besser ausgerüsteten Truppen, die Gegenoffensive, die Ende Juli 1525 in der bedingungslosen Kapitulation der Bauernhaufen endete.
Der Bauernkrieg im Hegau und auf dem Bodanrück dauerte nur wenige Monate, hinterließ aber ausgeplünderte Dörfer, zerstörte Weinberge, vernichtete Ernten und forderte über 70.000 Menschenleben. Obwohl die Aufstände letztendlich scheiterten, trugen sie dazu bei, das Bewusstsein für Freiheitsrechte zu stärken und die Notwendigkeit von Reformen zu schärfen.

Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurden Freiheitsrechte in Verfassungen aufgenommen und als unverhandelbare Grundrechte in das Grundgesetz geschrieben.
An dieser Stelle müssen wir noch die Bedeutung und Rolle des Sernatinger Frühmesser Johannes Hüglin erwähnen, der 2 Jahre nach Beendigung des Bauernkrieges als Sündenbock des Klerus und der Obrigkeit, angeklagt, gefoltert und zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt wurde. Von den 21 Anklagepunkten, die gegen ihn vorgebracht wurden, war der erste, dass er die Beschwerden der aufrührerischen Bauern aufgeschrieben und ihnen zugestimmt habe.
Über ihn gibt es einen eigenen Bericht der SeeEnd-Geschichten, Buch-Band 1, Seite 78.